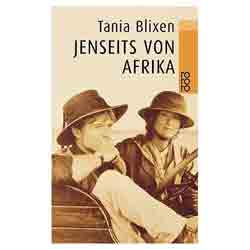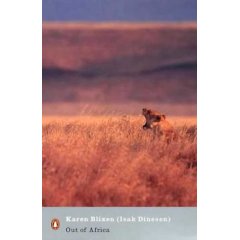| |
Über Schein und Sein – nicht nur in Afrika
“An der Biegung des großen Flusses” ist nur sehr oberflächlich gesehen ein Roman über das Leben im postkolonialen Afrika –
denn wie der aufmerksame Leser rasch bemerken wird, könnte sich die Geschichte, die sich um Schein und Sein im
Leben dreht, ebenso gut hier bei uns zutragen. Gerade diese Übertragbarkeit und die enorme Vielschichtigkeit machen
diesen Roman richtig genial und aussagekräftig.
Die Hauptfigur Salim, ein indischer Kaufmannssohn, verlässt die heimatliche afrikanische Ostküste, um im Landesinnern
mit einem eigenen Laden sein Glück zu suchen. Doch das Land befindet sich im Umbruch. Salim ist ein Fremder in der
Fremde, ebenso wie auch die aus anderen Teilen des Kontinents stammenden Afrikaner Metty, ein Nachkomme der Haussklaven der
Familie, der Salim ungebeten von der Ostküste nachgefolgt ist, und Ferdinand, dem aus dem Süden stammenden Sohn einer in einem
Nachbardorf lebenden Händlerin, der das hiesige Gymnasium besucht. An ihnen und anderen Charakteren zeigt Naipaul,
wie schwierig es sein kann, seinen eigenen Weg auf dem schmalen Grat zwischen Sein und Schein zu finden, zumal noch in einem Land,
in dem jegliche Sicherheiten für eine solide Lebensplanung fehlen.
Der Ich-Erzähler Salim wird zunächst als ein sehr unsicherer Mensch beschrieben, der stets großen Wert auf die Sichtweise
anderer legt und sich an dieser zu orientieren versucht. Diese Unsicherheit, aus der Zukunftsängste erwachsen, gibt er
bereits anfangs in einem Rückblick auf seine Kinder- und Jugendzeit an der ostafrikanischen Küste zu, als ihm erst
durch die Abbildung einer Dhau auf einer europäischen Briefmarke bewusst wird, was die Region, in der er lebt,
eigentlich ausmacht (S. 25): „... So lernte ich erstmals wirklich sehen.. Schon in frühen Jahren gewöhnte ich mir
also an, richtig hinzusehen – einen Schritt zurück zu treten und das Vertraute mit Abstand zu betrachten.
Aus diesem Abstand schien es mir immer stärker, dass wir uns als Gemeinschaft überlebt hatten. Und damit begann
meine Unsicherheit ...“. Im Verlauf des Romans wird jedoch deutlich, welch eine Entwicklung Salim durchlebt,
wie er zusehends „wirklich sieht“ und das Gebaren der anderen, die einst Leitbilder für ihn waren, durchschaut
und dadurch selbstsicherer wird. Zunächst aber wird Salims Unsicherheit dadurch verdeutlicht, dass er vor
allem die Meinung und das Handeln von Bekannten und Freunden beschreibt, diese zum Vorbild nimmt und sich selbst und
seine eigene Meinung mehr oder weniger dahinter verschanzt. Zu diesen Personen zählen unter anderem Indar und Raymond.
Im Verlauf des Romans werden jedoch beide dieser Idole in sich zusammenstürzen:
Indar, sein Freund aus Kindheitstagen, outet sich selbst indem er zugibt, wie erfolglos sein bisheriges Leben trotz des
Studiums in England war. Allein geplagt von der Sorge, als Ausländer aus einem Entwicklungsland bloß nicht
überwältigt von all dem Neuen um ihn herum zu wirken, hat er nach eigenem Befinden von der fremden Kultur nichts
begriffen, nichts hinterfragt, nichts dazugelernt (S. 211).
Raymond steht dem Präsidenten nahe und gilt überdies als Afrikaexperte, als „einer der Großen Afrikas“.
Doch wie groß ist Salims Entsetzen, als er dessen Veröffentlichungen durchliest und feststellen muss, dass dieser
Europäer in seinen Artikeln zur neuesten afrikanischen Geschichte nie etwas kritisch hinterfragt hat, nie mit
Augenzeugen gesprochen hat, kurzum: dass er überhaupt nichts von Afrika verstanden hat ...
Interessant in Bezug auf Europäer ist aber bereits Salims Erkenntnis auf Seite 27: „.. Feste Vorstellungen ...
machten ihre Überlegenheit aus. Die Europäer wollten Gold und Sklaven ... aber zugleich wollten sie sich als Wohltäter der
Sklaven ein Denkmal setzen ...“, – und es gelang ihnen beides. Durchaus auf das Heute übertragbar.
Die interessanteste Nebenfigur des Romans ist wohl Ferdinand, dessen Entwicklung vom jugendlichen Afrikaner zum
Staatsbediensteten die kulturelle Zerrissenheit des postkolonialen Afrikas offen legt. Ferdinand ist ein afrikanischer
Jugendlicher ohne die räumliche Nähe des Vaters auf der Suche nach kultureller Identität, Selbstwertgefühl und einem
eigenen Lebensweg, ohne dabei jedoch auf ein wegweisendes Leitbild zurückgreifen zu können.
Sein Freund Metty dagegen bleibt stets farblos und unterwürfig, ein ehemaliger Sklave, der es nicht wagt,
sein eigenes Schicksal eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen, sondern sich stattdessen immer von jemanden abhängig
machen will, von dem er sich Reichtum und Ansehen verspricht.
Was an all den beschriebenen Charakteren (Nazruddin, Mahesh, Indar, Raymond) so interessant ist, ist wie sie sich
alle verbiegen und verstellen, um vor sich und anderen etwas darzustellen – mehr Schein als Sein, wie immer und überall also.
Und wie auf dem Buchrücken bereits zu lesen ist: „...So ist die Welt; wer nichts ist, wer es geschehen lässt, dass aus
ihm nichts wird, hat keinen Platz darin ...“ Allein Salim bleibt sich gemäß der Weissagung Nazruddins selber treu,
verkauft sich nicht und hat es so gesehen als einziger geschafft, mit sich selbst in Frieden zu leben und glücklich zu sein.
Ein sehr vielschichtiger Roman, der weiten Interpretationsspielraum lässt, aber dennoch leicht zu lesen ist.
|
|